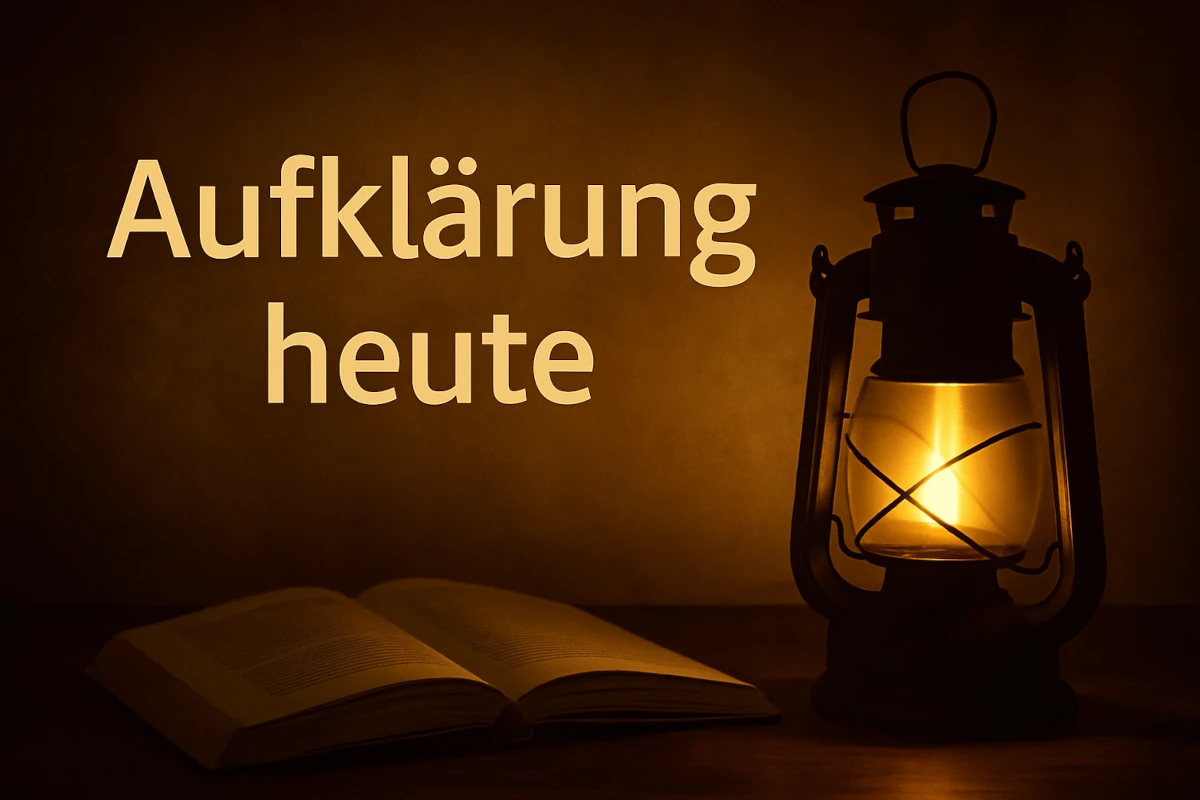„Die Lehrer – und mit ihnen die etablierten Theologen – wussten, warum sie sich hermeneutischen Übungen entzogen. Eine allzu kritische Koran-Exegese hätte sie, die Hüter der Tradition, über kurz oder lang um Amt, Macht und Würde gebracht. Doch ihre Weigerung hat weitere, teilweise vielleicht sogar gute Gründe: In jenen Jahren – insbesondere nach der Eröffnung des Suezkanals 1869 – hielt der Kapitalismus Einzug in Ägypten. Dass Zeit fortan Geld ist, hatten die Ägypter bald begriffen. Insbesondere in Kairo stieg der Erwerbsdruck. Nicht wenige Menschen entflohen ihm in Spielsucht, Prostitution und Alkoholismus – für die Hüter der Tradition ein gewichtiges Argument, ihre Schutzbefohlenen von der Schädlichkeit der westlichen Moderne zu überzeugen. Fortan befinden sie sich im Kulturkampf.
An dessen vorderster Front steht der Islam. Die Lehre verhärtet sich, verliert an Elastizität. Die Auswirkungen der ideologischen Verhärtung beobachtete der französische Islamwissenschafter Ernest Renan 1883 am Verhalten heranwachsender Muslime. «Mit Beginn seiner religiösen Initiation, im Alter von zehn oder zwölf Jahren, wird ein islamisches Kind, das bis dahin ganz aufgeweckt war, mit einem Mal fanatisch. Es ist auf dümmliche Weise stolz, etwas zu besitzen, was es als die absolute Wahrheit erachtet, glücklich über ein scheinbares Privileg, das doch seine Unterlegenheit ausmacht. Dieser verrückte Stolz ist das grundlegende Laster der Muslime.»“ (…)
und ergänzend
http://www.nzz.ch/articleD7B09-1.11190