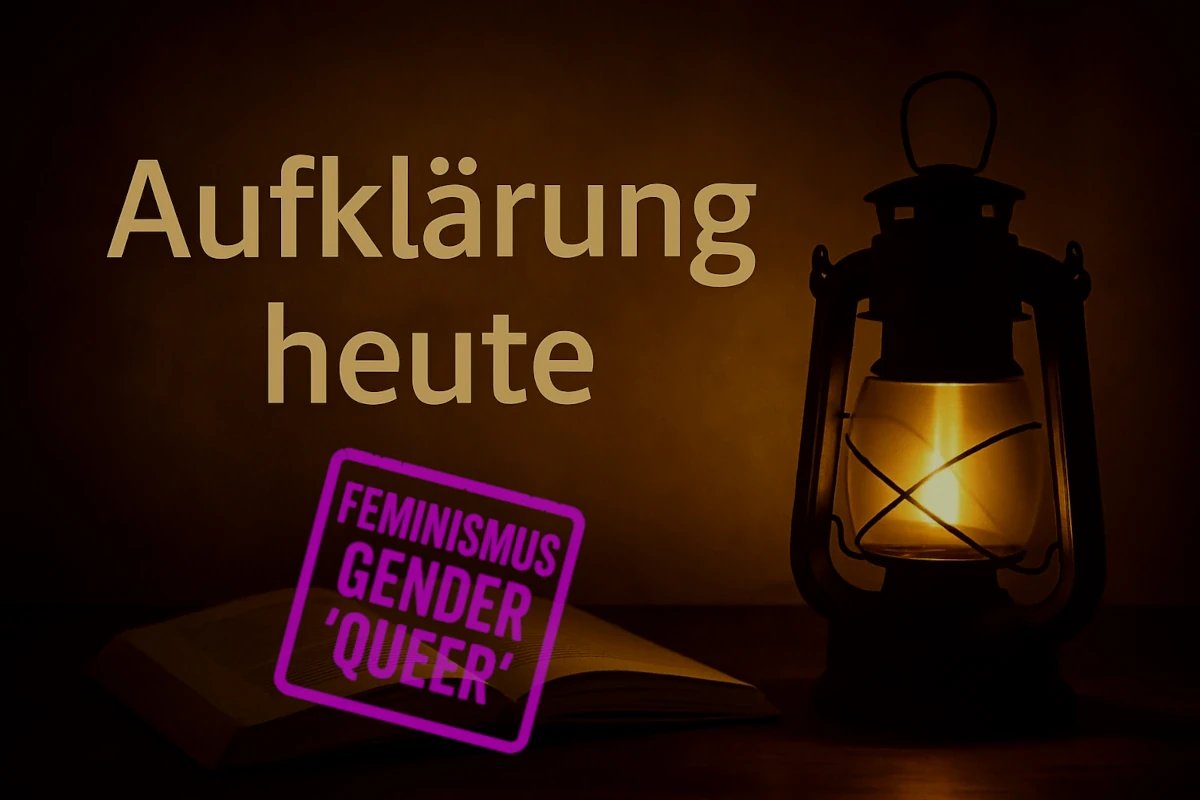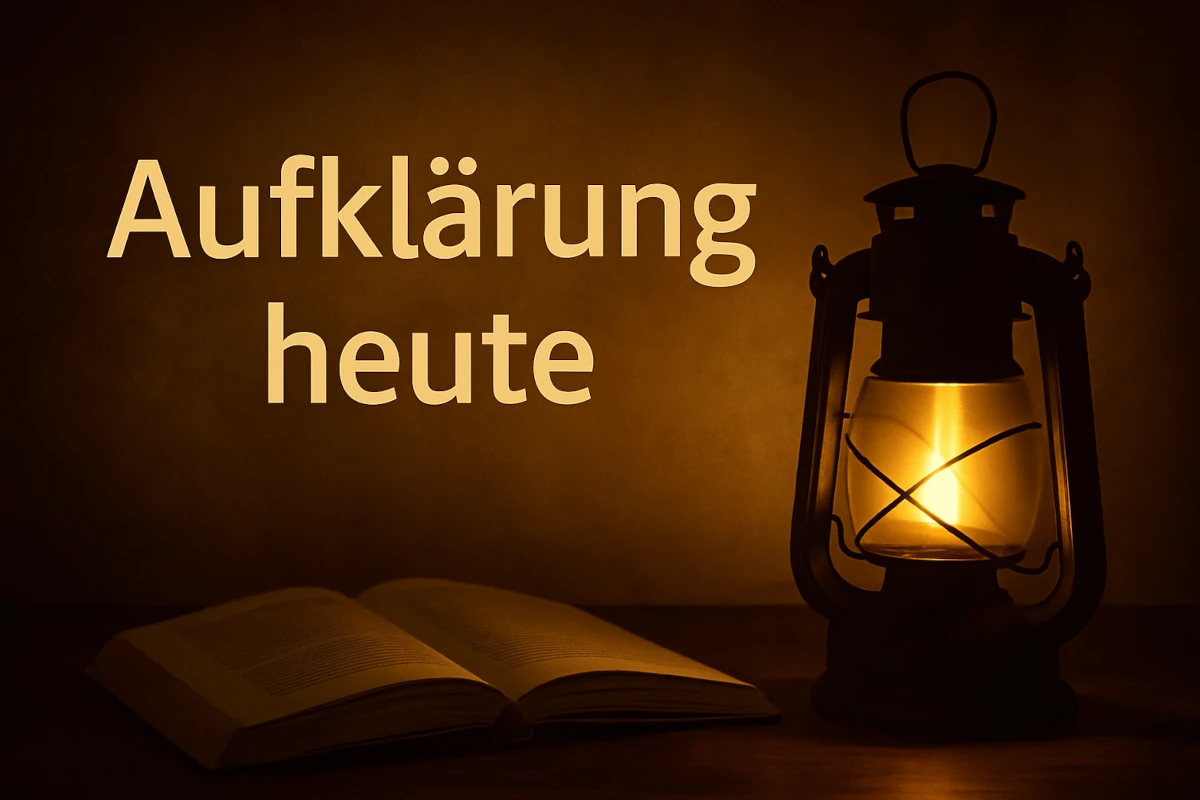„Wirft man einen Blick auf die Geschichte der Altersvorsorge in Deutschland, so könnte man zu einem polemischen Fazit gelangen: Konservative waren für die großen fortschrittlichen Reformen verantwortlich, die Sozialdemokratie hingegen für den großen Rückschritt. Wie jede Polemik wäre diese nicht ganz zutreffend. Ganz falsch aber eben auch nicht.
Es war Reichskanzler Otto von Bismarck, der 1889 ein erstes „Gesetz betreffend die Invaliditäts- und Alterssicherung der Arbeiter“ verabschieden ließ. CDU-Bundeskanzler Konrad Adenauer führte 1957 eine große Rentenreform durch, die vor allem in zweierlei Hinsicht deutliche Verbesserungen brachte: Erstens sollten die Renten nun nicht mehr nur ein minimales Alterseinkommen garantieren, sondern den Lebensstandard sichern. Dazu wurden sie „dynamisiert“, in ihrer Höhe also an die Entwicklung der Löhne gekoppelt. Zweitens stellte die Bundesregierung auf das „Umlageverfahren“ um. Damit wurden die Renten fortan unmittelbar aus den Beiträgen der Versicherten finanziert, die durch diese Beitragszahlungen wiederum Ansprüche auf spätere Renten erwarben („Generationenvertrag“). Das Umlageverfahren war auch eine Lehre daraus, dass am Kapitalmarkt angelegte Altersvorsorge-Gelder zuvor mehrfach durch Wirtschaftskrisen vernichtet worden waren.
Um die Höhe der Altersrente zu berechnen, waren damit fortan drei Faktoren ausschlaggebend: Zum Ersten die relative Lohnposition der Versicherten – wer mehr verdient, bezahlt höhere Beiträge und bezieht später eine höhere Rente. Zum Zweiten die Versicherungsdauer – wer länger arbeitet, bezahlt mehr Beiträge und bezieht später ebenfalls eine höhere Rente. Als Beitragszeiten in diesem Sinne gelten heute etwa auch Kindererziehung, Arbeitslosigkeit (ALG I), Pflege von Familienangehörigen sowie eine berufliche Ausbildung. Zum Dritten schließlich orientiert sich die Rentenhöhe zumindest im Grundsatz am Niveau der Löhne und Gehälter zum Zeitpunkt des Rentenbezugs. So werden Rentner/innen nicht vom allgemeinen Wohlstand abgekoppelt.
Die Berücksichtigung dieser drei Faktoren stellte lange weitgehend sicher, dass der Lebensstandard abhängig Beschäftigter auch im Alter gewahrt blieb. Zugleich erwies sich die Altersrente damit zumindest für die meisten abhängig Beschäftigten als weitgehend armutsfest. Ergänzt war sie um zwei weitere Leistungen der gesetzlichen Rentenversicherung: eine Absicherung für Hinterbliebene („Witwenrente“, „Waisenrente“) sowie bei Erwerbsminderung.
Ab den 1990er Jahren aber begann sich ein Wandel abzuzeichnen. Am Arbeitsmarkt griffen atypische und prekäre Beschäftigungsformen immer weiter um sich. Schon damit wurden und werden Einkommen von Arbeitnehmer/inne/n zum Kapital umverteilt. Während beispielsweise Gewinn- und Unternehmenseinkommen zwischen 2000 und 2015 inflationsbereinigt um über 30 Prozent anstiegen, wuchsen die Einkommen je abhängig erwerbstätiger Person im gleichen Zeitraum nur um knapp drei Prozent. Und selbst von diesen profitierte letztlich nur ein Teil der abhängig Beschäftigten.“ (…)
http://www.annotazioni.de/post/1926