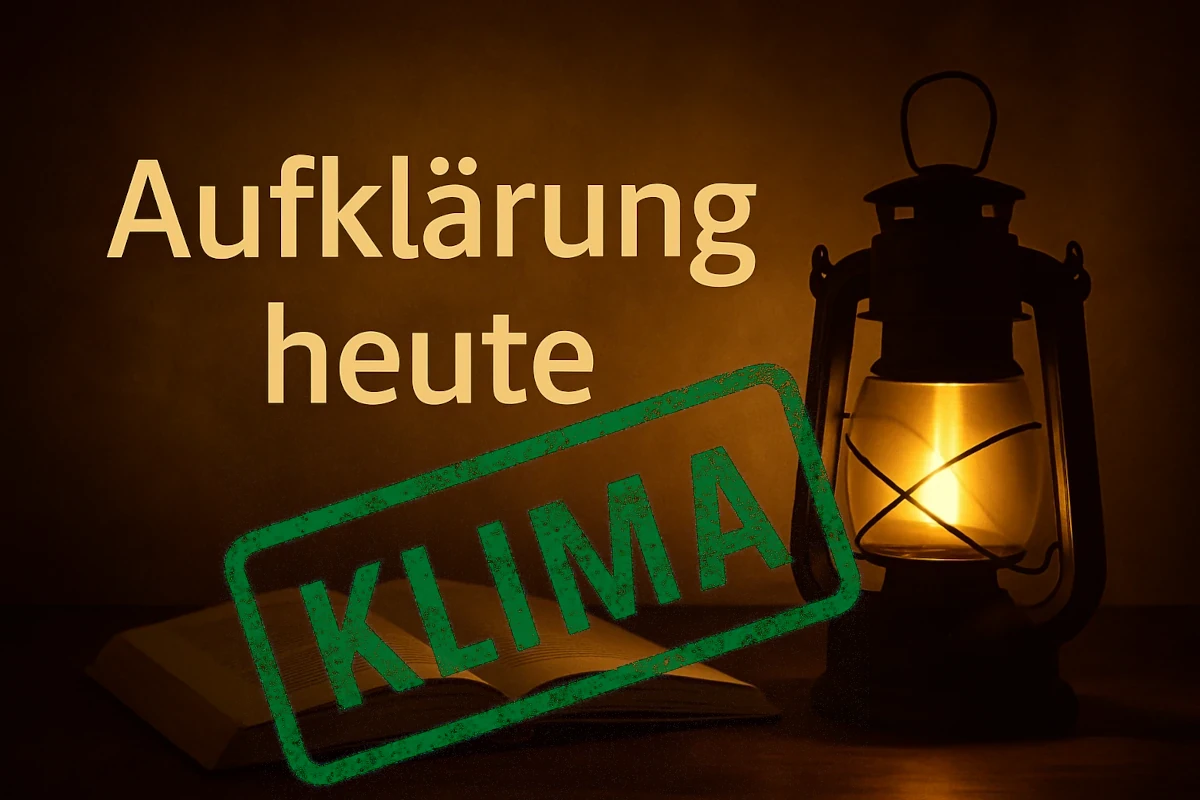Buchbesprechung:
von Michael Mansion
Es mag Leute geben, die dem Autor eine Masche unterstellen, weil er seine Texte sexuell auflädt, aber das ist ein Missverständnis, denn es geht ihm um eine Antwort auf die Frage, warum es Männer und Frauen nicht oder nicht mehr schaffen, ganz einfache, in uns angelegte Freuden weniger angstvoll miteinander zu teilen und welche künstlichen Verdikte der Verhinderung in Anwendung gebracht werden, mit denen wir uns einreden, sie seien zeitgemäß, modern, emanzipatorisch und antidiskriminierend.
Wir exhibitionieren uns in den Sozialen Netzwerken und in den Medien, aber diese einfache, unbeschwerte und erlösende körperliche Nähe wird uns immer fremder und verdächtiger. Es scheint uns irgendwie zu viel, zu aufdringlich und vor allem zu verpflichtend. Wozu?
„Gnädige Frau, sie haben einen geilen—na sie wissen schon. Das geht garnicht und schöne Brüste muss man anstandshalber unmöglich finden, weil sie eine Frau darauf reduzieren, also im Falle eines Lobes derselben.
Man selbst wird dabei längerfristig zu einem Neutrum und kann sich in absehbarer Zeit vermutlich das Geschlecht in dem man leben will selbst wählen. Ein großartiger Sieg der liberalen Demokratie, welchen der Autor offenbar nicht zu feiern bereit ist und es dabei dennoch schafft, das Gesamtgeschehen nicht komplett der Häme zu überantworten. Er erzählt uns Geschichten von den verschiedensten Leuten, von Ehepaaren, die seit Jahren keinen Sex mehr hatten, von Rentnern, Homos, Nudisten, Hippies, Opportunisten, Frauen, die einen nicht erlösen, Spinnern, Intellektuellen und Schlampen.
Wenn es schwierig wird, muss es mal ein Cardenal Mendoza-Brandy richten, um einer unerträglichen Leere zu entgehen, die auch ein Teil Spaniens sein kann, wo sich einiges abspielt in diesem Roman zwischen schnurgeraden, glühend heißen Autobahnen, mit dämlichen Beschränkungen. Ein Land, das auf die Chinesen wartet, weil man sich längst aufgegeben hat, zumal man sich verständlicherweise nicht dauerhaft das Geschwätz der europäischen Rentner über die Prostata-Operation und den letzten Bypass anhören kann, ohne irrsinnig zu werden.
Wenn der Protagonist mit einer Frau unterwegs ist, die er nicht oder nicht mehr liebt, dann wird das zu einem Stück vom unvermeidlichen Alltag, ein Stück der selbst gemachten Hölle, die sich steigert in einer Umgebung, die man kennt, wo man Bezüge herstellen kann und deshalb noch mehr darunter leidet. Er hasst deshalb auch Paris,diese „von umweltbewussten Kleinbürgern zerstörte Stadt“.
Eine dieser nicht mehr geliebten Frauen hat eine etwas exzentrische Libido, aber so schlecht war das auch nicht, bis auf die Pornos auf ihrem Computer, die offensichtlich in seiner Abwesenheit in seinem Appartment entstanden waren was so schlimm nicht wäre, „hätte man zu diesen Zeiten nicht noch zusammen gevögelt“.
Die Frage die sich stellt ist doch: Was macht man dann? Man könnte sie (sie wiegt nur etwa 50 kg.) aus dem Fenster schmeißen, aber dann droht Strafe und was macht man so lange im Knast?
Der Autor hat einen subtilen Zugang zur französischen Seele und ihren Abgründen, ihrem Fluchtreflex.
Huellebecq ist ein Artist der erotischen Befindlichkeiten und mindestens die Männer sind ihm zu Dank verpflichtet, wenn er aus ihnen keine grundsätzlich zur Liebe unfähigen Schlappschwänze macht, sondern eher Missverstandene, die etwas konfus dem Phänomen der weiblichen Lust begegnen und nicht so recht wissen, ob sie sich freuen oder ein schlechtes Gewissen haben sollen, weil man ihnen die Verachtung des eigenen Penis antrainiert hat.
Der Fluchtversuch des Protagonisten ist ein Dauerzustand und er verlängert seinen Hotelaufenthalt von Woche zu Woche, sowie die Örtlichkeiten, während er einen Psychologen aufsucht, der ihm Captorix verschreibt, ein Antidepressivum, dem er nicht traut, aber es wirkt zumindest ein bisschen gegen die Traurigkeiten, über alles mutwillig oder unfähig Zerstörte und Misslungene, was einfach vorbei ist, uneinholbar und nicht ersetzbar wie ein abgebrochenes Stück vom Leben.
„Niemand ist mehr glücklich im Abendland,-die historischen Bedingungen sind nicht mehr gegeben“, sagt die Ex-Freundin Claire.
Der Protagonist ist in wechselndem Umfeld mit wechselnden Partnerinnen unterwegs. Die Arbeit ist ungeliebt, aber gut bezahlt, die umliegenden Lokale gut, die Speisekarten vielversprechend und die Antidepressiva werden durch Alkohol ergänzt.
Es ist die Apokalypse eines Mannes in den mittleren Jahren, der sich selbst Bindungsunfähigkeit unterstellt und in einer gewissen Panik alte Freundinnen anruft, deren aktuelle Sorgen genmanipuliertes Soja, ein möglicher Sieg des Front National oder Feinstaubdebatten sind.
Dazwischen blitzt das kleine Glück in Erinnerung an Landausflüge und Urlaube mit den Eltern, als eine Begleitmusik zunehmender Kraftlosigkeit mit dem Verlust vieler Interessen.
Eine Tristesse, die sich heiterer Betrachtung überlässt und es knapp vermeidet, das eigene Leben als total verpfuscht zu begreifen.
Es ist aber nicht nur das Private der hier vorkommenden gesellschaftlichen Subjekte. Der Autor ist bekannt für seine wie nebenbei dialogisch angelegten Gespräche vom und über den Zustand einer offenbar nicht allzu gut verwalteten Republik, deren arrogante Eliten ihre Latifundien an die Chinesen verkauft und sich selbst in einem Dschungel von Vorschriften nahezu handlungsunfähig machen.
Ob eine erotische Aufladung die Trostlosigkeit bricht oder einfach nur ein Stilmittel des Autors ist, der damit gekonnt umgeht, müssen seine Leser entscheiden.
Der pädophile deutsche Ornithologe, der zwischendurch auftaucht, ist keine Figur, die viel vermittelt, aber sie steht hier (erneut) für Armseligkeit.
Das Schießen zu üben, bei einem alten Freund, der über ein ganzes Waffenarsenal verfügt, aber ein tragischer Großbauer ist, hat für den Protagonisten etwas von Yoga, so lange ihm dabei nicht der Gedanke kommt, er hätte damit auch den pädophilen Deutschen umlegen können oder wen auch immer aus den Reihen der Kaputtmacher. Ein paar Zielübungen können auf jeden Fall mal nicht schaden.
Am Beispiel des Desasters der französischen Landwirtschaft, welche ihre Wirte nicht selten in den Selbstmord getrieben hat, entwickelt der Autor eine hoch dramatische Situation, die auf eine verhängnisvolle Entscheidung hinausläuft.
Ist hier die Vorstufe zum Bürgerkrieg angedacht oder seine Verstärkung, weil Frankreich ihn ja bereits durch die an Migranten verlorenen Stadtteile hat, in denen es wochenendliche Randale gibt?
Ist das unvermeidlich, oder ist die Schlacht gegen den Globalismus ohnehin nicht zu gewinnen?
Kann es sein, dass die Generation Smart-Phone aus ihrem Halbschlaf erwacht, weil sie einsieht, dass sie alles verlieren könnte? Alles—-und das sogar in Minutenschnelle!
Die politische Klasse herrscht über die Medien in denen sie bei Bedarf die Welt umdeutet, was gelegentlich auffällt. Das weiß auch der Protagonist, weil er gebildet und der gelegentliche Gedanke an Gewalt ihm nicht fremd ist, aber er fragt bei aller Einsicht:
„Wer war ich, dass ich glaubte, etwas am Lauf der Welt ändern zu können“?
Da ist sie dann wieder, diese luzide Resignation, die sehr wohl ein Feindbild hat, ihm aber die Konsequenz verweigert.
Und die Liebe? Die Liebe zu Camille und der wahnwitzige Gedanke, sie notfalls durch Mord zu reinszenieren. Dieser unglaubliche Hunger nach Geborgenheit. Und was macht man, wenn einem der Arzt sagt, man sei auf dem besten Wege an Kummer zu sterben?
Dieser ganze Versuch, mit so wenig Tabletten und so wenig Alkohol wie möglich zu überleben, ist schon schwer genug und wird noch weiter erschwert, „durch die kleinlichen Arschlöcher mit ihren Rauchverboten, gegen die zu kämpfen sinnlos ist, weil sie in der Überzahl sind und einen noch dazu zwingen, sich für die Unannehmlichkeiten zu entschuldigen, die man ihnen verursacht.
Es ist schlussendlich diese kleine weiße Tablette, der Gedanke an den lieben Gott und die Sicherheit, dass man alleine sterben wird ohne noch einmal geliebt zu werden.
Ein ganz normales Leben also, in dem sich die Leser wiederfinden können—–wenn sie wollen. –